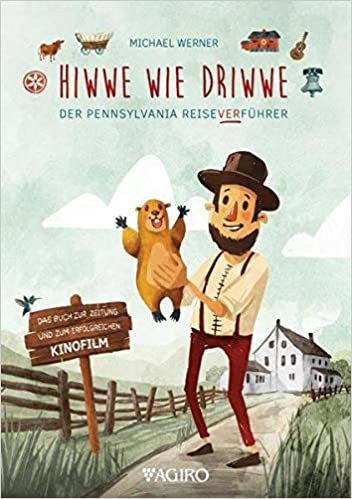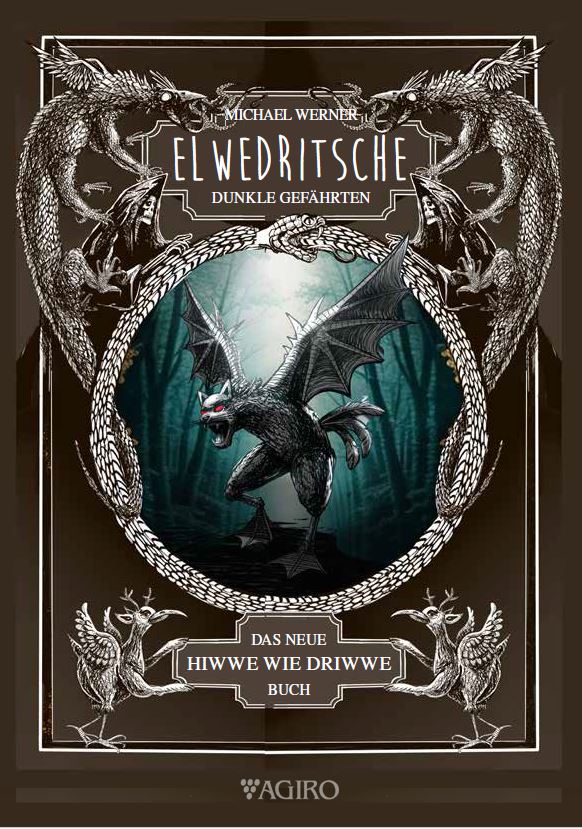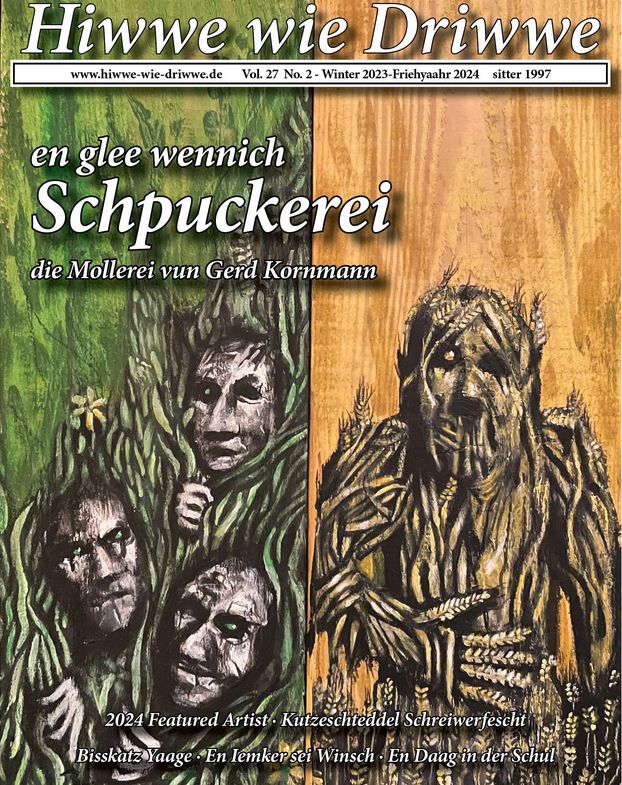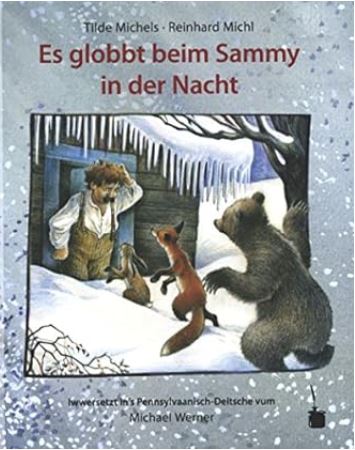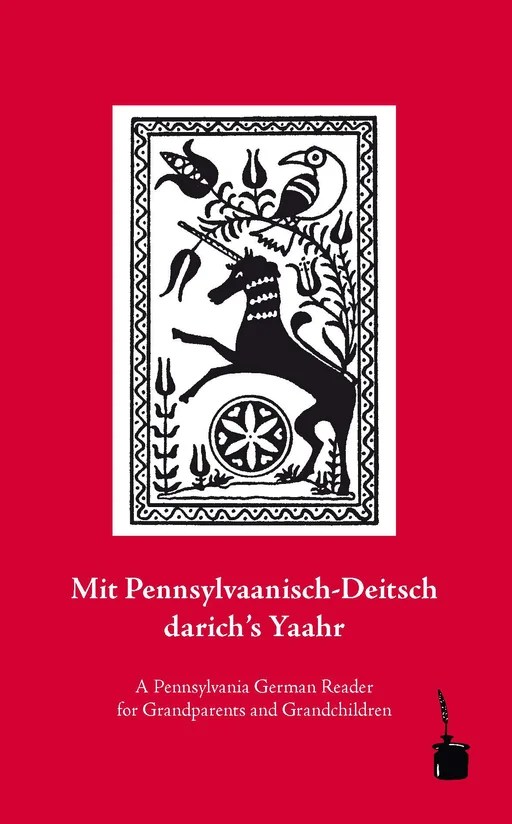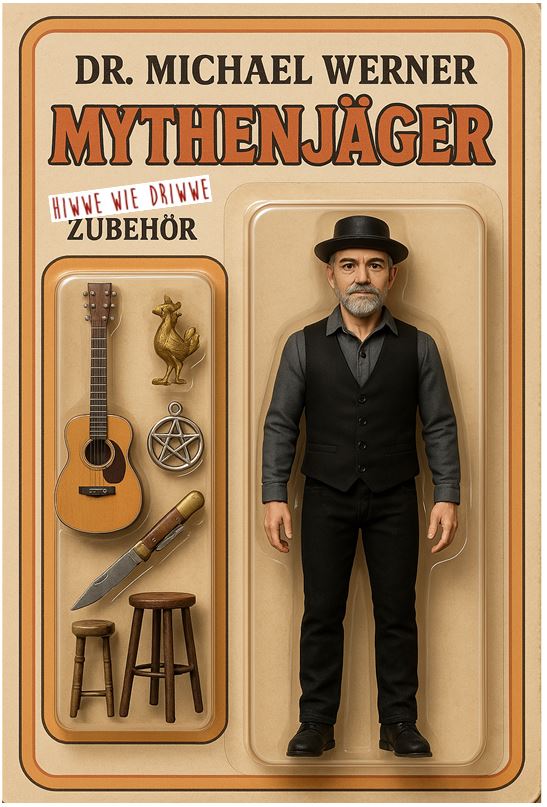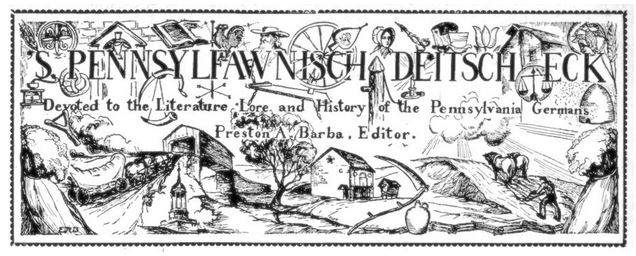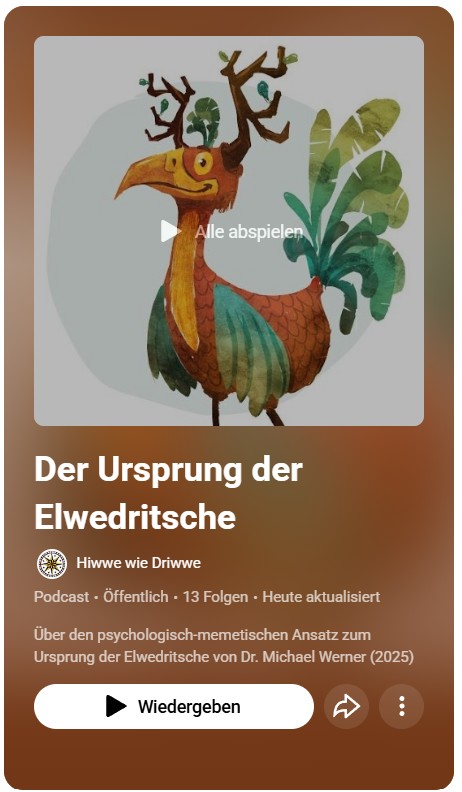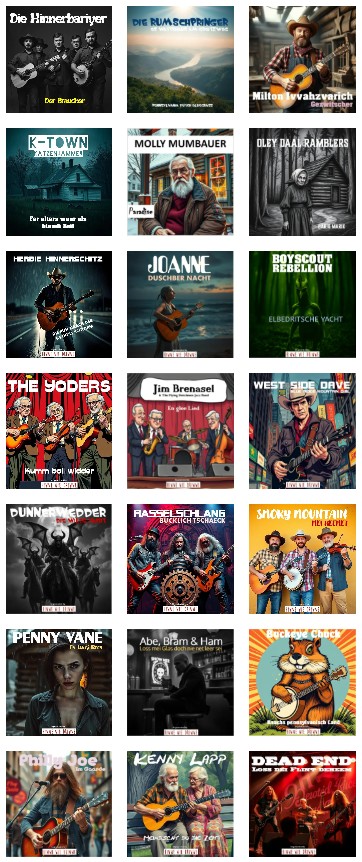Von Michael Werner
Man kann immer wieder lesen, die Vorfahren vieler Pennsylvania-Deutscher seien aus der Pfalz ausgewandert – „Palatinate“ oder „Lower Palatinate“ heißt die Gegend dann in englischen Artikeln. Das ist bestimmt nicht falsch, aber auch nicht wirklich richtig. Denn das, was wir heute als Pfalz verstehen, also der südliche Teil des Landes Rheinland-Pfalz, existierte so im 18. Jahrhundert nicht.
Mannheim war bis 1777 die Hauptstadt der Kurpfalz, deren Territorien unter anderem auch die Oberämter Alzey, Bacharach, Kreuznach, Oppenheim, Simmern, Stromberg, Veldenz, Heidelberg, Ladenburg, Umstadt (bei Darmstadt) und Mosbach (Odenwald) umfasste. Kurz: Die Pfalz damals reichte weit über die heutige Pfalz hinaus. Sie war ein Staat mit einiger Bedeutung, hatte sogar die Kurwürde, also das Recht, den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation mitzuwählen.
1778 wurde die Hauptstadt nach dem Aussterben der bairischen Wittelsbacher im Zuge einer Erbabwicklung von Mannheim nach München verlegt. Die Kurpfalz war im neu entstandenen Herzogtum Pfalz-Baiern aufgegangen. 1792 wurden die linksrheinischen Teile von französischen Revolutionstruppen besetzt und 1798 auch völkerrechtlich französisch, was sie bis 1814 blieben. Danach bekam Bayern die linksrheinischen Territorien zugeschlagen. Sie hießen nun „Rheinbaiern“ (später Rheinpfalz bzw. Pfalz genannt). Damit war die Landkarte komplett neu gezeichnet: Es gehörten Landstriche zur Pfalz, die niemals kurpfälzisch waren, z. B. Speyer. Auf der anderen Seite hatten viele rechtsrheinische Gebiete sowie linksrheinische Gebiete nördlich von Frankenthal und Grünstadt neue – hessische – Herren gefunden.
Wie überhaupt: Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Landesherren ab dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein Territorien kauften, verkauften, verpfändeten oder verschenkten, als seien es Äcker in ihrem Besitz. Und was sich auf diesen Äckern befand – nämlich die Menschen – wurde entsprechend mit verschachert. Insoweit handelte der Adel seinerzeit ein wenig so wie Landwirte heute, wenn sie über ihr Eigentum verfügen.
Für die Pennsylvania-Deutschen macht das die Sache unübersichtlich. Wie alle Amerikaner lieben sie Familienforschung. Da kann es sein, dass Unterlagen in ihrem Besitz sie in die Irre führen. Etwa, wenn es heißt, ein Vorfahr sei 1830 aus Bayern eingewandert – nämlich aus Edenkoben. Oder ein Ahne sei 1745 aus der „Pfaltz“ gekommen, genauer gesagt, aus Sinsheim.
Der Begriff „Palatinate“ existiert im Englischen, aber die Menschen verbinden meist keine spezielle Region mit ihm. Sprechen Pennsylvania-Deutsche von der Heimat ihrer Vorfahren, hört man meist: „Mei Voreldre sinn aus em alte Land kumme“. Oder „Mei Voreldre waare deitsch“. In einer englischen Unterhaltung fallen Begriffe wie „Rhine Valley“ und „South-Western Germany“. Mehr wissen sie nicht, weshalb sie auch nicht ahnen, dass sie heute mit Menschen links und rechts des Rheins viel mehr verbindet, als sie denken: eine gemeinsame Geschichte, eine ähnliche Mundart und vergleichbare kulturelle Muster. Und deshalb sind sie in Pennsylvania auch immer ebenso erstaunt und erfreut, wenn sie jemandem begegnen, der sie quasi in ihrer Muttersprache anspricht. Oft können sie es überhaupt nicht glauben – vor allem die „Amish“. „Was saagscht?“, wird ungläubig gefragt, oder „Saag’s widder!“
Nach zwei oder drei weiteren Sätzen ist dann meist klar, ob eine Unterhaltung in „deitsch“ funktioniert. Und wenn, dann hat man als Deutscher mit (kur-)pfälzischen Wurzeln wirklich einen entscheidenden Vorteil. Man kann diese Menschen kennenlernen wie kaum jemand sonst. Jedenfalls, wenn man nicht hochdeutsch spricht.
Ein guter Bekannter, der 2001 im Alter von 87 Jahren verstorbene Carroll Bingaman aus Reading (PA) mit Vorfahren aus Edenkoben, war seit einem ersten Besuch in Deutschland als junger Mann ab den 1950er Jahren jedes Jahr immer wieder in die Pfalz gekommen. Er war unverheiratet, und irgendetwas zog ihn immer wieder in die Heimat seiner Vorfahren.
Als ich ihn kennenlernte, war er schon 80 Jahre alt und sagte jedes Mal beim Abschied von Deutschland: „Des war es letscht Mol, ass ich do waar. Neegscht Yaahr kumm ich nimmie.“ Und ein Jahr danach läutete das Telefon, und am anderen Ende sagte eine Stimme: „Ich bin widder do!“

Carroll erzählte mir einmal von seiner Lieblingsbeschäftigung. Er sagte, er sitze oft einen ganzen Nachmittag im Park am Mannheimer Wasserturm auf einer Bank und erzähle mit älteren Damen. Dann frage er immer: „Was meenscht du, wu ich herkumm?“ Und wenn die Antwort dann zum Beispiel war: „Ich weess net, Sie sinn net vun Mannem, awwer vielleicht vun Frankedahl, gell?“ – dann freute er sich wie ein kleines Kind. Er jedenfalls hatte seine Pfalz wiedergefunden.